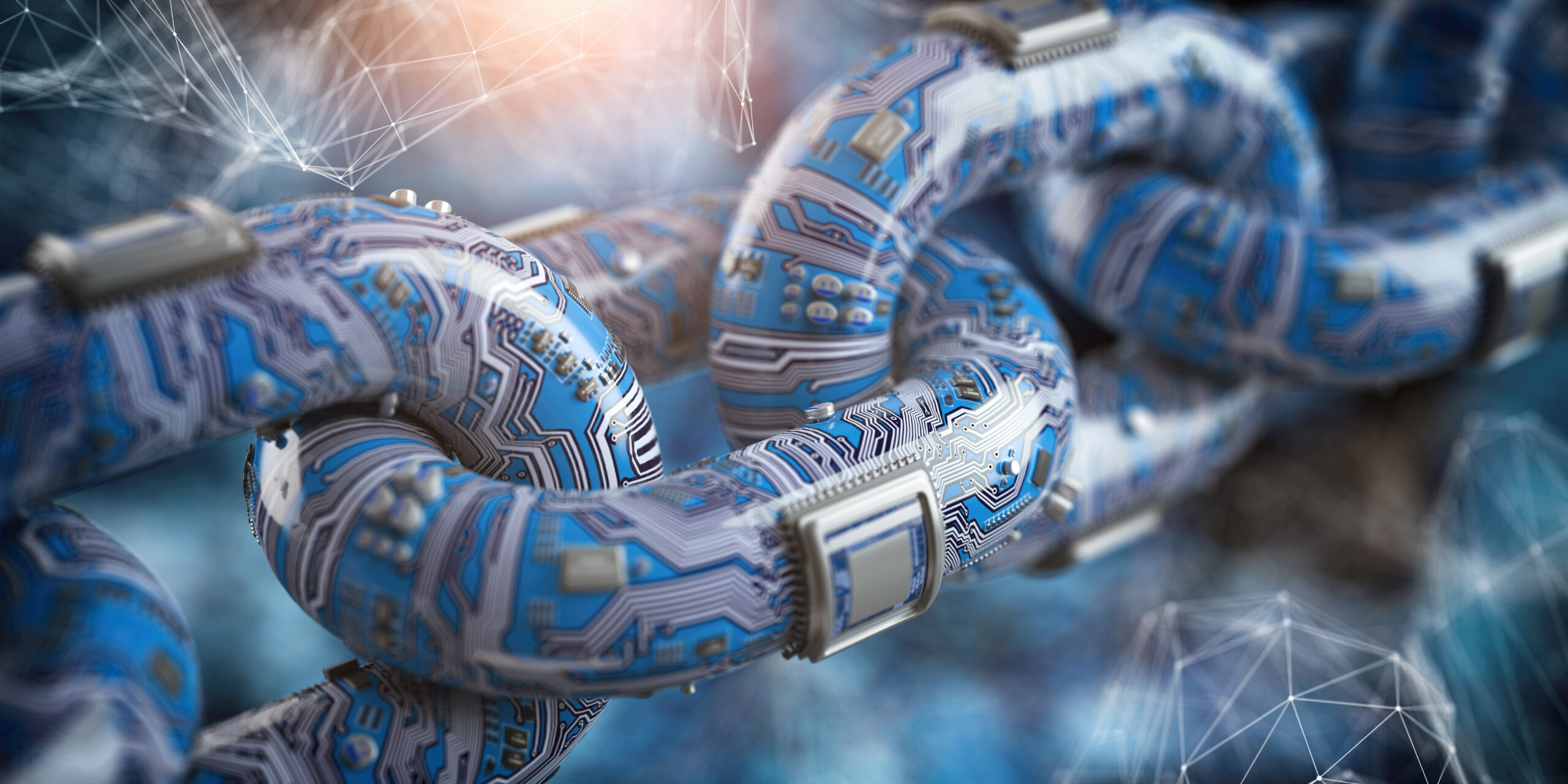Häppchen & Ausgangslage
Mit penetranter Regelmäßigkeit taucht in Diskussion von, bei, mit und um Juristen die Frage auf, ob man sich eigentlich im täglichen Geschäftsbetrieb nur um Paragrafen und Gesetzeslücken kümmere („Winkeladvokatur“) oder auch das Große und Ganze im Blick behalte: die Gerechtigkeit. Und irgendwie fühlt man sich in solchen Situationen – in denen man übrigens meist ein Käsehäppchen in der einen, ein stilles Mineralwasser in der anderen Hand sowie den Mund halbvoll hat – wie die große Koalition, die auch jeder bedrängt, sie möge nicht immer nur an alltäglichen Kleinigkeiten herumwursteln, sondern sich bitte der systematisch-klaren Linie widmen. Das ist nicht angenehm, zumal man als Anwalt nicht mal eben so die Steuern erhöhen oder ein paar Krankenkassen schließen kann, um darauf folgend ein Bier in der VIP-Lounge eines WM-Stadions zu trinken und den Kaiser zu herzen.
Auf die Frage nach der Gerechtigkeit gibt es viele völlig richtige und dennoch unbefriedigende Antworten. Etwa die, dass man speziell als Anwalt zwar Organ der Rechtspflege sei, damit schon der Gerechtigkeit irgendwie verpflichtet, nebenbei aber auch Interessenvertreter. Und als solcher begeht man, wenn man eben nicht nach dem besten Weg für den Mandanten sucht, einen Parteiverrat und wandert im besten Fall ins Gefängnis. Als Richter wiederum ist man schon recht zufrieden, wenn man zumindest prognostizierbare Entscheidungen produziert, das Recht technisch richtig anwendet und damit Rechtssicherheit und Rechtsfrieden erzeugt. Das ist nämlich schon eine ganze Menge.
Aber das beantwortet die Frage natürlich nur ungenügend.
Ich persönlich ziehe es in solchen Situationen vor, mit der Aufforderung zu antworten, man möge doch bitte – damit ich ausreichend Stellung nehmen kann – erst einmal „Gerechtigkeit“ genau definieren. Meist hat man damit genügend Luft, noch einen leichten Salat vom Buffet zu holen und dann schnell das Thema zu wechseln.
Die Frage steht damit weiter im Raum. Fundierte Antworten sind rar. Wer mal ein Semester Philosophie studiert hat, am richtigen Grundlagenschein im Jurastudium arbeitete oder einfach nur gut googlen kann, der weiß immerhin, dass sich schon Platon an einer Antwort versucht hat und nach vielem Nachdenken zum Schluss kam, man möge doch jeden so behandeln, wie es ihm zustehe. Das ist übrigens nach wie vor die vernünftigste Gerechtigkeitsdefinition.
Aber wirklich nutzen tut sie nichts. Man kann sie einerseits genauso gut falsch besetzen wie jede andere Leerformel – was die Nationalsozialisten ja vorexerziert haben, indem sie „Jedem das Seine“ an das Tor zum KZ Buchenwald schrieben. Man kann sich aber vor allen Dingen darüber streiten, was denn das „Seine“ sein solle. Perelman etwa (Chaim Perelman, „Über die Gerechtigkeit“) führt auf (für die inhaltliche Gerechtigkeit übrigens, nicht die Verhandlungsgerechtigkeit; die Kommentare in den Klammern sind nicht von ihm):
- Jedem das Gleiche (klingt nach Kommunismus)
- Jedem gemäß seinen Verdiensten (was dann wieder irgendjemand bewerten muss)
- Jedem nach seinen Werken (das könnte – wenn man die Werke in Geld ausdrücken kann – neoliberal sein)
- Jedem nach seinen Bedürfnissen (das war ein Slogan, der damals Losung hieß, der SED)
- Jedem gemäß seinem Rang (finsteres Mittelalter)
- Jedem gemäß dem ihm durch das Gesetz zugeteilten (für die Positivisten unter uns. Schließt die Party-Frage aber ziemlich kurz).
Was bringt uns das?
Immerhin hat man so die Diskussion eine Schraube höher gedreht. Herausgearbeitet ist, dass man Vergleichbares gleich behandeln soll – so steht es ja auch im Grundgesetz. Man streitet sich jetzt nur noch darum, was denn bitte „vergleichbar“ heißt. Denn es ist unschwer zu erkennen, dass die Antworten der Liste nicht nur zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, sondern sich teilweise schlicht gegenseitig ausschließen. Man kommt damit nicht umhin, aus diesen Vorgaben auszuwählen, oder jedenfalls einen passenden Mix zu bilden.
Aber wie kann diese Auswahl unter den unterschiedlichen Ansätzen die Gerechtigkeit betreffend geschehen? Offenbar doch nur, indem man auf Werte zurückgreift. Da man aber Gerechtigkeit will und nicht Willkür, müssen das allgemeinverbindlichen Werte sein. Wie kommt man an die? Perelman (aaO.) meint:
Es ist so, dass für jede Gesellschaft und für jeden Geist Handlungen, Handelnde, Glaubenshaltungen und Werte bestehen, welche in einem bestimmten Augenblick rückhaltlos gebilligt und nicht mehr diskutiert werden, die man daher nicht zu rechtfertigen braucht. Diese (…) liefern Präzedenzfälle, Modelle, Überzeugungen und Normen (…).
So etwas konnte man (übrigens in seiner Fassung schon sehr vorsichtig formuliert!) in einer – nach heutigen Maßstäben – uniformen Gesellschaft im Europa Mitte des 20. Jahrhunderts sicher schreiben. Heute könnte man das nicht mehr. Der Ansatz passt schlicht nicht auf eine Gesellschaft mit zunehmend disparaten Strömungen, Subkulturen, Milieus. Es gibt keine gemeinsame Basis. Da ist nichts, das als Grundlage dienen kann. Die Scheidelinie zwischen den unterschiedlichen Werten verläuft dabei näher als wir denken, oder genauer: es gibt sehr viel mehr Scheidelinien, als man gemeinhin zu glauben meint, was dem Erkenntniswert des Begriffs der „Scheidelinie“ übrigens kaum gut tun kann. Wenn dann etwa versucht wird, gemeinsame „westliche“ Werte gegen die gefühlte Bedrohung durch fundamentalistische Glaubenssysteme in Stellung zu bringen, dann stellen wir, wenn wir um uns schauen und meinen, feste Stellungen und klare Fronten zu erblicken, schnell fest, dass die gar nicht da sind. Dass die Amerikaner einen ganz anderen Freiheitsbegriff haben als die Europäer. Und auch „Demokratie“ seinerseits erst einmal der Definition bedürfte. Wobei übrigens auch „Amerikaner“ und „Europäer“ nur aggregierte, unscharfe und nichts sagende Bezeichnungen für wankende und wechselnde Mehrheiten mit bestimmten geographischen Schwerpunkten sind.
Natürlich kann man sich auf den Punkt der „politischen Gerechtigkeit“ zurückziehen. Somit davon ausgehen, dass gerecht ist, was nach legitimer Willensbildung des Volkes eben als gerecht angesehen wird. Aber kann etwas, das heute gerecht ist, denn plötzlich, nach vier Jahren, nach einer neuen Wahl, plötzlich ungerecht sein? Heißt so verstandene Gerechtigkeit nicht, den Begriff seines eigentlichen Sinns zu entleeren?
Wertediskussionen
In der Tat sieht Perelman (aaO.) das Problem. Und so führt er neben der allzu vergänglichen politischen noch die philosophische Gerechtigkeit ein. Dort geht es um universale, allgemein gültige Werte, die für alle – die gesamte Menschheit – verbindlich sind. Wenn man da ist, ist man bei Kant, dem bestirnten Himmel und dem moralischen Sittengesetz. Ersatzweise kann man – je nach Glaubensrichtung – auch die goldene Regel oder die Vorschläge des neuen Testaments einsetzen. Oder einer anderen heiligen Schrift. Oder Heilslehre. Oder Irgendwas.
Werte sind verschieden, relativ.
Das kann man durchaus, wie es der Papst tut, angreifen und verdammen. Die katholische Kirche tut sich da leicht, denn sie zieht ihre schiere Daseinsberechtigung aus der Tatsache, unumstößliche Wahrheiten und damit auch die richtigen – allgemeingültigen und universalen – Werte zu besitzen. Kritischere Geister haben es da schwerer, etwa Engisch („Auf der Suche nach Gerechtigkeit“), wenn er sich zum Werterelativismus bekennt.
Ja und?
Lässt sich bei dieser Ausgangslage der Begriff „Gerechtigkeit“ mehr als nur vage ausfüllen? Ja und nein. Immerhin weiß man auf diese Weise, was Gerechtigkeit bedeuten kann, was man darunter zu verstehen hat im Sinne einer Übereinkunft über die formale Struktur, die Form des Begriffes. Nur weiß man immer noch fast nichts über seinen inneren Gehalt. „Gerechtigkeit“ ist keine Leerformel mehr in dem Sinn, dass man nicht wüsste, worüber man eigentlich redet. Aber sie bleibt relativ. Es stellt sich heraus, dass es nicht „die“ Gerechtigkeit gibt, sondern nur Zustände (oder auch: Verhaltensweisen, Verfahren, Ergebnisse), die man je nach Wertvorstellungen als gerecht empfinden mag oder auch nicht.
Anders gesagt: man kann keine Diskussion dahingehend führen, dass ein bestimmter Vorgang gerecht oder ungerecht sei. Man kann nur sagen, dass man ihn für gerecht oder ungerecht halte.
Was tun?
Man kann mit guten Gründen der Meinung sein, dass das zuwenig ist. Dann gibt es wohl zwei Möglichkeiten.
Entweder man gibt klar zu erkennen, dass man „Gerechtigkeit“ im Sinn der politischen Gerechtigkeit versteht. Also das für gerecht hält, was die (politische) Mehrheit als solches ansieht. Dann aber kann man dem Juristen nicht vorwerfen, dass er sich erst einmal am geschriebenen Gesetz orientiert und damit arbeitet, es als Maßstab seines Handelns nimmt. Denn eben dieses Gesetz hat ja eine (politische) Mehrheit beschlossen. Es „ist“ somit gerecht. Es gibt dann keine Orientierung am „großen Ganzen“, an einer übergesetzlichen Gerechtigkeit.
Oder man muss fair zu sich selbst und den anderen sein und den philosophisch gebrauchten Begriff „Gerechtigkeit“ unterfüttern; klar zu erkennen geben, welche Gerechtigkeit an welchen Maßstäben gemessen man eigentlich meint. Natürlich macht das eine Diskussion sperrig und den Begriff unhandlich, weswegen er insbesondere bei 20 Sekunden Politiker-Statements vermieden werden sollte.
Trifft man also auf jemanden, der den Begriff ohne eine solche Eingrenzung benutzt, dann diskutiert man alternativ oder kumulativ
- mit jemandem, der es schlicht nicht besser weiß, keine Gedanken an den Begriff verwendet,
- mit jemandem, der davon ausgeht oder jedenfalls hofft, dass sich die Art von Gerechtigkeit, die gemeint ist, aus dem Kontext ergibt oder und am schlimmsten,
- mit einem Demagogen.
Weiterlesen
Larenz, „Methodenlehre der Rechtswissenschaft“
Zippelius, „Rechtsphilosophie“
Über den Autor
Aktuelles
Weitere Beiträge des Autors
BGH zu Affiliate-Marketing: Alles ist schrecklich, aber Amazon haftet trotzdem nicht für seine Partner
Amazon muss nicht für seine Affiliate-Partner haften, entschied der Bundesgerichtshof. Rechtlich ist das Urteil kaum zu beanstanden, aber trotzdem hinterlässt es einen bitteren Nachgeschmack. Eine Einschätzung von Arne Trautmann. (mehr …)
DAO: Die codierte Organisation
Haben Sie schon jemals darüber nachgedacht, was sich hinter dem Begriff „dezentralisierte autonome Organisation“ (DAO) verbirgt und welchen Einfluss die DAO im Alltag hat? Arne Trautmann berichtet aus der Fachwelt. (mehr …)