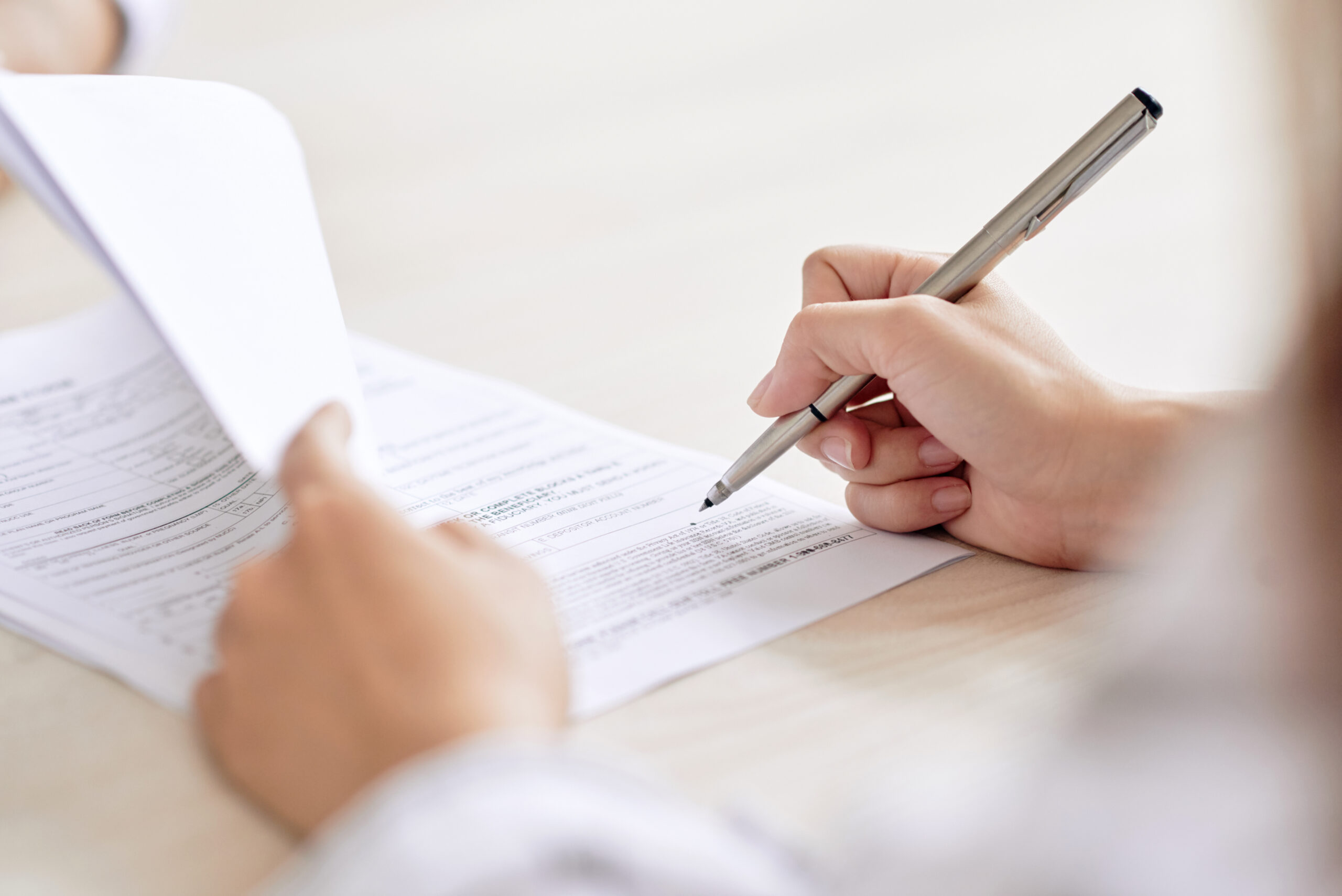Pläne können sich ändern, beruflich wie privat. Wenn Gesellschafter sich dann trennen, gibt es häufig Streit über die Abfindung für den Ausscheidenden. Wer wann was bekommt, was Gesellschafter früh klären sollten und was sie später vielleicht noch retten können, erklärt Dr. Wolfgang Heinze.
Ob ein Gesellschafter selbst kündigt oder von den übrigen Gesellschaftern ausgeschlossen wird: Die Rechtsstreitigkeiten über die Abfindung für den Ausscheidenden können sich über Jahre hinziehen. Für den Gesellschafter kann das gravierende Konsequenzen haben. Aber auch für die Gesellschaft kann allein die Ungewissheit darüber, was sie auszahlen muss, im schlimmsten Fall existenzbedrohend sein.
Künftige Gesellschafter sollten sich daher am besten im Vorfeld auf eine Abfindungsklausel einigen, die zu den eigenen Plänen, aber auch zu der geplanten Gesellschaft und ihrer Zukunft passt. Selbst wenn Klauseln unter Umständen vereinbart wurden, die sich heute geändert haben oder den ausscheidenden Gesellschafter drastisch benachteiligen, ist noch nichts verloren.
Der Grundsatz: Der Anteil, den man beim Ende der Gesellschaft bekäme.
Wer aus einer Gesellschaft ausscheidet, bekommt eine Abfindung in Höhe des Wertes seiner Beteiligung. § 738 Abs. 1 S. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sieht vor, dass die Gesellschaft dem Ausscheidenden „dasjenige zahlen [muss], was er bei der Auseinandersetzung erhalten würde“.
Bei der Auseinandersetzung, wenn die Gesellschafter die Gesellschaft also einvernehmlich beenden oder liquidieren, erhält jeder von ihnen vom verbleibenden Reinvermögen der Gesellschaft den Anteil ausbezahlt, der seiner Beteiligung entspricht. Der Rechtsgedanke dieser Vorschrift gilt für alle Gesellschaftsformen mit Ausnahme der Aktiengesellschaft.
Der Anspruch auf die Abfindung entsteht mit dem Ausscheiden aus der Gesellschaft, d.h. zum Ablauf der jeweiligen Kündigungsfrist. Allerdings kann im Gesellschaftsvertrag eine abweichende Auszahlungsbestimmung vereinbart werden. Schließlich kann die Abfindung auch beschränkt werden. Oft sollen solche Beschränkungen den Liquiditätsabfluss bei der Gesellschaft gering halten, damit diese — im Interesse der verbleibenden Gesellschafter — lebensfähig bleibt.
Beschränkte Abfindungen — und ihre Grenzen
Unbegrenzt ist das allerdings nicht möglich. So kann eine Klausel, die eine Abfindung festlegt, die schon bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags unverhältnismäßig vom Verkehrswert abweicht, wegen Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB unwirksam sein. Die Abfindung ist dann nicht mehr nach dem Vertrag, sondern nach § 738 BGB zu bestimmen.
Außerdem kann eine Abfindungsklausel nachträglich unwirksam werden, wenn der vereinbarte Wert später drastisch vom Verkehrswert abweicht. Dann kann ein Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) oder eine verbotene Kündigungsbeschränkung vorliegen. In diesen Fällen wird ermittelt, wie die Parteien die Abfindung festgelegt hätten, wenn sie gewusst hätten, wie sich der Verkehrswert entwickeln würde.
Die Sittenwidrigkeit und der Verstoß gegen Treu und Glauben sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die Vorschriften sind die am wenigstens präzisen Normen des deutschen Zivilrechts. Entsprechend unsicher sind Prognosen über den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten: Es kommt maßgeblich darauf an, wie das Gericht den Sachverhalt bewertet und den Gesellschaftsvertrag auslegt.
Verkehrswert oder Buchwert?
Enthält der Vertrag keine vom Gesetz abweichende Regelung oder ist diese aus den genannten Gründen unwirksam, steht dem ausscheidenden Gesellschafter nach § 738 BGB eine Abfindung in Höhe des Wertes seiner Beteiligung zu. Nach der Rechtsprechung erhält er dann entsprechend seiner Beteiligungsquote einen Anteil am „wirklichen Wert des Unternehmens einschließlich aller stillen Reserven und einschließlich des good will des Unternehmens“, also den Anteil am Verkehrswert der Gesellschaft.
Dieser Wert der Gesellschaft muss ermittelt werden. Können die Gesellschafter sich nicht auf eine Bewertungsmethode einigen, wird ein Sachverständiger beauftragt, der anhand anerkannter Maßstäbe der Unternehmensbewertung (z.B. der Standard IDW S 1) ein — regelmäßig recht aufwändiges – Gutachten erstellt.
Um diesen Aufwand zu vermeiden, sehen viele Gesellschaftsverträge einfachere Bewertungsmethoden vor wie z.B. die sog. Buchwertklausel: „Der Gesellschafter erhält eine Abfindung in Höhe des Buchwertes seiner Beteiligung gemäß dem Jahresabschluss für das letzte vor dem Zeitpunkt des Ausscheidens abgeschlossene Geschäftsjahr.“ Eine solche Klausel will eine Beteiligung an den stillen Reserven und dem zwischenzeitlich geschaffenen Geschäftswert / good will ausschließen. In anderen Fällen wird auf ähnliche vergangenheitsbezogene Werte oder die Substanzwerte verwiesen oder z.B. ein Multiplikator auf den letzten durchschnittlichen Jahresgewinn angenommen.
Solche Klauseln können zu der Gesellschaft gut passen. Oft führen sie aber ihrerseits zu Streit, weil der Ausscheidende seinen Anspruch für übermäßig reduziert hält. Umgekehrt haben sich gerade in den vergangenen Jahren viele Buchwertklauseln als Bumerang erwiesen. Wenn im Rahmen eines Konjunkturabschwungs wie der Corona-Krise beispielsweise auf die Jahresabschlüsse 2019 oder 2020 abgestellt wird, weisen diese einen höheren Wert aus, Wertminderungen aufgrund der Pandemie werden nicht berücksichtigt. Dann kann der Buchwert über dem tatsächlichen Verkehrswert eines Gesellschafteranteils liegen. Bisher haben Gerichte solche Klauseln nicht beanstandet.
Besser vorher prüfen
Ganz unabhängig von der Größe der Beteiligung und ihren zukünftigen Plänen lohnt es sich also für Gesellschafter stets, schon vor dem Beitritt zu einer Gesellschaft oder ihrer Gründung die Ausscheidens- und Abfindungsklauseln im Vertrag zu prüfen.
Wichtig ist es dabei, alle Perspektiven einzunehmen: Selbst wer dauerhaft in der Gesellschaft bleiben möchte, sollte sich überlegen, wann und mit welcher Abfindung die Mitgesellschafter zukünftig ausscheiden können. Immerhin belastet die Abfindung die Liquidität der Gesellschaft im Zweifel erheblich, im schlimmsten Fall müssen die verbleibenden Gesellschafter die Summe sogar finanzieren.
Umgekehrt will, wer doch ausscheidet, einen fairen Wert für seine Beteiligung erhalten und nicht „ausgehungert“ werden. Und schließlich möchte keiner der Gesellschafter seinen Abfindungsanspruch verlieren, wenn die Gesellschaft in die Insolvenz rutscht, weil sie nicht liquide genug ist, um den Anspruch des Ausscheidenden zu begleichen.
Was Ausscheidensklauseln regeln sollten
Ausscheidens- und Abfindungsklauseln sollten daher mindestens folgende Punkte umfassen:
- die Bewertungsmethode zur Ermittlung des Unternehmenswertes
- die Festlegung des Bewertungsstichtages
- ein Verfahren zur Bestimmung des Schiedsgutachters vornimmt und zu den Kosten des Gutachtens
- die Abfindung generell oder in bestimmten Ausscheidenskonstellationen (Tod, außerordentliche Kündigung etc.) reduzierende Vorgaben
- frühester Auszahlungszeitpunkt, Ratenzahlungstermine und Verzinsung unter Berücksichtigung etwaiger steuerlicher Verpflichtungen des Ausscheidenden
- vorsorglich das Recht der Gesellschaft, die Abfindung auch vorzeitig auszuzahlen
- Regelungen zur Beteiligung an noch schwebenden Geschäften bzw. dem laufenden Geschäftsjahr
- - abhängig von der Gesellschaftsform — ggf. Regelungen zu positiven/ negativen Salden auf Gesellschafterkonten
- den Ausschluss der Veränderung des festgestellten Unternehmenswertes durch spätere steuerliche Änderungen.
Die Gesellschafter sollten in Abstimmung mit den steuerlichen/ wirtschaftlichen Beratern eine Bewertungsmethode wählen, die zur Gesellschaft und ihrem Unternehmen passt. Unterschiedliche Geschäftszwecke beeinflussen die Abfindungsberechnung deutlich: Bei einer Grundstücksgesellschaft stehen andere Wertentwicklungen und Risiken im Raum als bei einer Handelsgesellschaft oder einem Industriebetrieb.
Der Liquiditätsbedarf und die Interessen, aber auch z.B. die Altersstrukturen der Gesellschafter können sich unterscheiden. So sind beispielsweise bei Familiengesellschaften weitergehende Beschränkungen möglich, um die Werte im Unternehmen zu erhalten.
In den Brunnen gefallen ist das Kind übrigens erst, wenn das Ausscheiden eines Gesellschafters wirklich ansteht: Bestehende Gesellschaften können und sollten ihre Abfindungsregelungen regelmäßig daraufhin überprüfen, ob die gewählte Bewertungsmethode noch der aktuellen Wirtschaftslage und den Interessen der Gesellschafter entspricht. Schließlich können Pläne sich ändern.
Der Autor Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Heinze ist Partner bei SNP Schlawien Rechtsanwälte. Der Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie für Vergaberecht berät schwerpunktmäßig mittelständische Unternehmen sowie Tochtergesellschaften und Niederlassungen deutscher und ausländischer Konzerne in allen Fragen des Handels- und Gesellschaftsrechts.
https://www.linkedin.com/in/wolfgang-heinze-a935a324/
Über den Autor

Dr. Wolfgang Heinze
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Fachanwalt für Vergaberecht
Aktuelles
Weitere Beiträge des Autors
AGB-Recht im B2B-Verkehr abwählen: Eine Schiedsklausel macht’s möglich
Das deutsche AGB-Recht ist zwingend – auch für Unternehmen untereinander. Doch nun hat der BGH festgestellt, dass Unternehmen bei Verträgen mit Auslandsbezug das deutsche Recht wählen, das AGB-Recht aber ausschließen können. Der Trick ist eine Schiedsklausel. Eine kleine Sensation im B2B-Rechtsverkehr. Ganz nebenbei hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einer Entscheidung aus dem Januar 2025 einen der wohl größten Schmerzpunkte...
Vorsicht bei Change-of-control-Klauseln: Nicht jede Änderung erlaubt die Kündigung
Wer sich dagegen absichern will, dass beim Vertragspartner die Verantwortlichen wechseln, nimmt in Verträge häufig eine Change-of-Control-Klausel auf. Doch pauschale Regelungen gehen oft zu weit. Das OLG Frankfurt a.M. hat eine solche Klausel für unwirksam erklärt – und macht klar, worauf Unternehmen vor allem bei langfristigen Verträgen achten sollten. Das OLG Frankfurt a.M. hat mit Urteil vom 21. Februar...