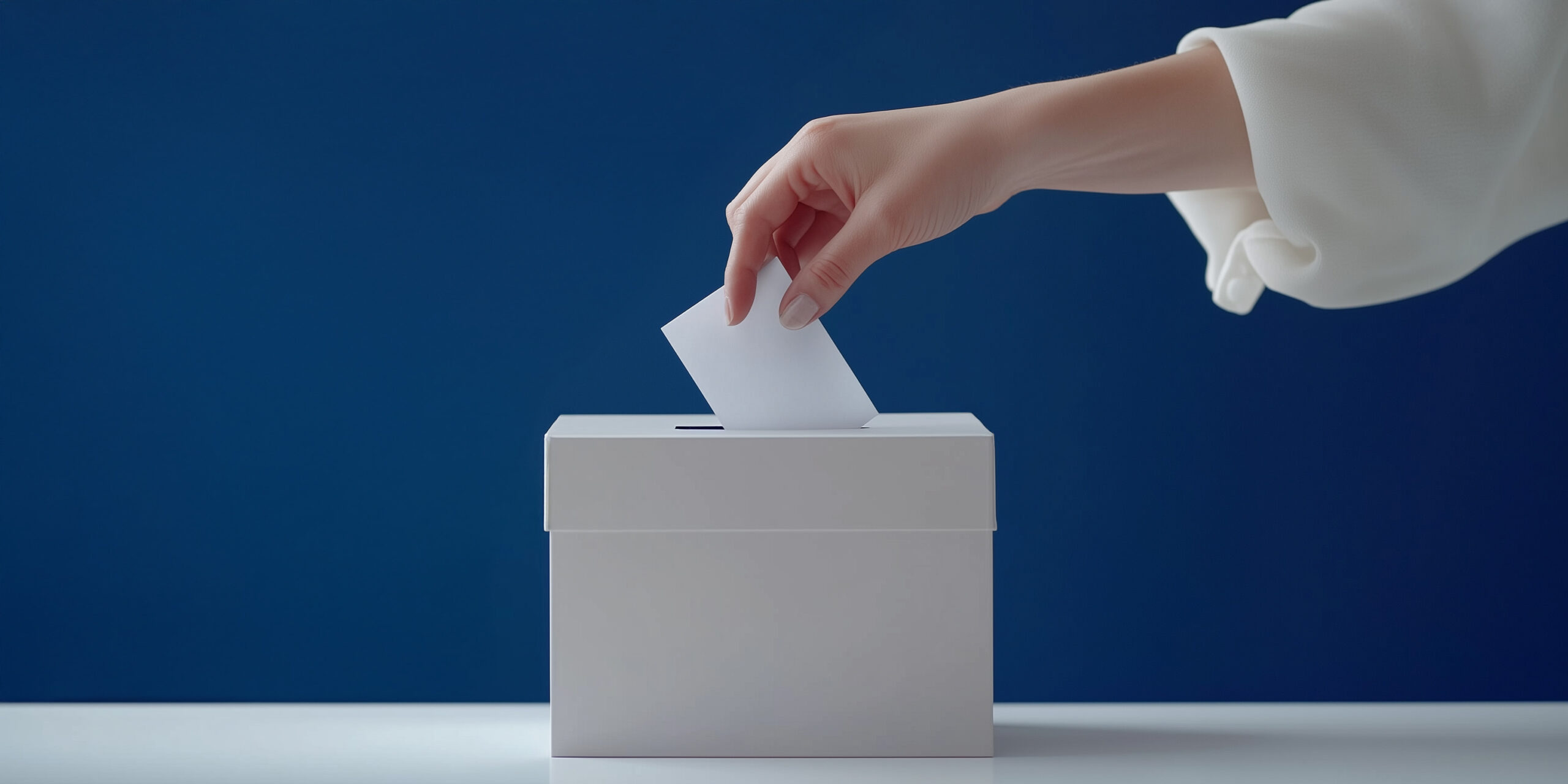Die personenbedingte Kündigung eines Mitarbeiters ist in der Regel nur wirksam, wenn zuvor ein ordnungsgemäßes betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt wurde. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, müssen Arbeitgeber Ablauf und Formalien des Verfahrens genau beachten.
Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist in § 167 Abs. 2 SGB IX (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch) geregelt. Danach bietet der Arbeitgeber Beschäftigten, die länger als sechs Wochen innerhalb eines Jahres arbeitsunfähig sind, ein BEM an. Gesetzgeberisches Ziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Arbeitnehmer ihre Arbeitsunfähigkeit überwinden und mit welchen Leistungen oder Hilfen sie einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorbeugen und ihren Arbeitsplatz langfristig erhalten können.
Die mehr als sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit müssen dabei nicht ohne Unterbrechung auftreten; es reicht aus, wenn die Summe der Arbeitsunfähigkeitstage innerhalb eines Jahres – gemeint sind hier die letzten 365 Kalendertage – mehr als sechs Wochen beträgt.
Das BEM ist also entweder das Mittel für den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer gezielt wieder in das Arbeitsumfeld zu integrieren – oder aber das Mittel, die rechtlichen Voraussetzungen für eine wirksame krankheitsbedingte Kündigung zu schaffen.
Keine Kündigung ohne ordnungsgemäßes BEM
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hat das BEM keine „Mindesthaltbarkeitsdauer“ (BAG, Urt. v. 18.11.2021, Az. 2 AZR 138/21): Es ist also ein erneutes BEM durchzuführen, sobald der Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach Abschluss der vorherigen Maßnahme wieder länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist.
Führt der Arbeitgeber kein BEM durch, hat das fürs Erste aber keine Konsequenzen; insbesondere haben die Beschäftigten keinen Anspruch auf ein BEM.
Erst wenn der Arbeitgeber einem häufig kurzzeiterkrankten oder langzeiterkrankten Beschäftigten kündigen will, sollte – oder muss – er ein BEM durchführen, weil die Kündigung sonst regelmäßig wegen Unverhältnismäßigkeit unwirksam ist. Ausnahmsweise verzichtbar ist ein BEM nur bei einer Kündigung während der Wartefrist nach dem Kündigungsschutzgesetz oder wenn es objektiv nutzlos wäre, wenn also die Maßnahmen keinesfalls zu einer Verbesserung führen könnten. Die Fälle, in denen die Rechtsprechung davon ausgeht, sind allerdings drastisch, so zum Beispiel bei einem Wachkoma oder einer schweren Alkoholerkrankung des Arbeitnehmers (vgl. BAG, Urt. v. 21.11.2018, 7 AZR 394/17, vgl. BAG, Urt. 20.03.2014, Az. 2 AZR 565/12).
Es gibt viele Fallstricke auf dem Weg zu einem ordnungsgemäß durchgeführtem BEM. Will der Arbeitgeber den Arbeitnehmer wieder in das Arbeitsleben integrieren, haben Fehler aber kaum Auswirkungen, solange Persönlichkeitsrecht und Datenschutz gewahrt sind.
Anders sieht es aus, wenn er das BEM nutzen möchte, um eine Kündigung vorzubereiten: Bereits ein nicht ordnungsgemäßes Einladungsschreiben reicht aus, damit die Gerichte das BEM – und damit die Kündigung – als fehlerhaft einstufen.
Erstkontakt und Einladung
Wenn der Arbeitgeber Handlungsbedarf feststellt, sollte er einen Erstkontakt mit dem betroffenen Arbeitnehmer herstellen und am besten einen Termin für ein erstes Informationsgespräch vereinbaren, in dem der Arbeitnehmer über Ziele, Beteiligte und Ablauf des BEM informiert und über den Datenschutz aufgeklärt wird. Dies kann allerdings auch schriftlich erfolgen.
Im Informationsgespräch oder im Einladungsschreiben muss das Ziel des BEM erläutert werden: Die Wiederherstellung und dann auch der Erhalt der Arbeitskraft sowie die Sicherung des Arbeitsplatzes; ein einfacher Verweis auf § 167 Abs. 2 S. 1 SGB IX reicht nicht aus. Aus dem Einladungsschreiben muss sich zudem ergeben, dass das Verfahren ergebnisoffen ist und auch der Arbeitnehmer aktiv eigene Vorschläge einbringen kann, um gemeinsam passende Lösungen zu finden.
Zudem sollten die am BEM-Verfahren beteiligten Personen genannt werden; deren Auswahl sollte sorgfältig erfolgen, denn sie kann entscheidend dafür sein, ob ein Arbeitnehmer das Angebot annimmt oder ablehnt. Zusätzlich ist es wichtig, den Arbeitnehmer darüber zu informieren, dass bei Bedarf weitere Stellen wie örtliche Rehabilitationsträger oder das Integrationsamt in das Verfahren eingebunden werden können. Darüber hinaus muss klargestellt werden, dass der Arbeitnehmer jederzeit das Recht hat, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen. Hinzuweisen ist darauf, dass der Arbeitnehmer seine Zustimmung zum BEM auch unter der Bedingung erteilen kann, dass der Betriebsrat und die ggf. hinzuzuziehende Schwerbehindertenvertretung nicht einbezogen werden.
Weiter ist der Ablauf eines BEM darzustellen: Der individuelle Fall wird besprochen, die individuelle Arbeitsplatzsituation gemeinsam analysiert, dann werden konkrete Maßnahmen entwickelt und vereinbart und danach umgesetzt.
Ferner muss der Arbeitgeber darauf hinweisen, dass die Durchführung des BEM freiwillig ist und nur mit der jederzeit widerruflichen Zustimmung des Mitarbeiters erfolgt, der Arbeitnehmer also „Herr des Verfahrens“ ist.
Achtung Datenschutz
Von zentraler Bedeutung für die Annahme des Angebots eines BEM ist der Datenschutz. Im Einladungsschreiben genügt ein Hinweis zur Datenerhebung und ‑verwendung, dass ausschließlich die zur Durchführung eines zielführenden BEM erforderlichen Daten erfasst werden (LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 26.10.2017 — 4 Sa 18/17). Die ausführlichen datenschutzrechtlichen Aspekte sollte der Arbeitgeber in einer separaten Anlage zur Einladung bereitstellen. Sie sollte detailliert aufführen, welche Daten im Sinne von Art. 9 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) im Rahmen des BEM erfasst werden, dass ausschließlich notwendige Daten erhoben werden und welcher Kategorie diese angehören. Zweck und Umfang der Datenverarbeitung, Zugriffsrechte, gesonderte Speicherung sowie die rechtliche Grundlage müssen transparent genannt werden. Zudem ist der Arbeitnehmer über sein Recht auf Auskunft sowie auf Löschung der Daten zu informieren.
Der Arbeitgeber sollte darauf achten, dass die Antwort des Arbeitnehmers zur besseren Dokumentation schriftlich erfolgt. Empfehlenswert ist, dem Einladungsschreiben ein vom Arbeitgeber entworfenes Antwortschreiben beizulegen, das der Arbeitnehmer nur noch auszufüllen braucht.
Lehnt der Arbeitnehmer das BEM ab, ist das Verfahren beendet – und für den Arbeitgeber, wenn das sein Ziel ist, der Weg zur Kündigung frei.
Das BEM-Verfahren richtig umsetzen
Nimmt der Arbeitnehmer das BEM an, ist das eigentliche BEM-Verfahren durchzuführen. Als konkrete Maßnahmen können zum Beispiel die stufenweise Wiedereingliederung, Arbeitsversuche, Belastungserprobungen, eine ergonomische Verbesserung oder technische Umrüstung des Arbeitsplatzes, die Umsetzung, eine berufliche Qualifizierung oder auch Maßnahmen des Gesundheitsschutzes wie die Vermittlung von Beratungs- und Betreuungsangeboten vereinbart werden.
Die vereinbarten Maßnahmen sind dann auch durchzuführen – würde der Arbeitgeber das nicht tun, wäre eine dennoch ausgesprochene personenbedingte Kündigung unwirksam. Anders sieht es aus, wenn der Arbeitnehmer die Maßnahmen abbricht.
Nach Abschluss der Maßnahmen wird deren Wirksamkeit bewertet. Waren sie wirksam, ist das bestmögliche Ergebnis des BEM erreicht, d.h. der Mitarbeiter ist gesundheitlich wieder in der Lage, im Betrieb zu arbeiten – waren die Maßnahmen nicht erfolgreich, führt dies häufig zu einer personenbedingten Kündigung.
Zu beachten ist, dass die für das BEM erhobenen Daten unbedingt getrennt von der Personalakte zu verwahren sind.
Praxistipp:
Arbeitgeber sollten ein BEM sorgfältig vorbereiten und planen. Wer eine personenbedingte Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen oder einer Langzeiterkrankung in Erwägung zieht, sollte diese möglichst zeitnah nach Abschluss des BEM-Verfahrens aussprechen. Erkrankt der Mitarbeiter nach Abschluss des BEM nämlich erneut für mehr als 42 Kalendertage, so wäre ein erneutes BEM durchzuführen. Denn rechtlich wirksam ist sie nur nach einem ordnungsgemäßen BEM.
Über die Autorin

Aktuelles
Weitere Beiträge der Autorin
Betriebsratswahlen 2026 (II): Immer noch analog
Im zweiten Teil unserer Mini-Serie "Betriebsratswahlen 2026" gehen wir der Frage nach, ob man den Betriebsrat mittlerweile auch online wählen kann. Das ist laut Betriebsverfassungsgesetz aber auch im März 2026 immer noch nicht möglich. Zwar macht der Koalitionsvertrag der Bundesregierung Hoffnung, geschehen ist aber noch nichts. Zu den Betriebsratswahlen müssen Unternehmen nach wie vor die Urnen- und Briefwahl richtig vorbereiten...
Kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates beim Datenschutz
Seit der Einführung der DSGVO entdecken Betriebsräte den Datenschutz verstärkt als neues Betätigungsfeld. Vor allem bei der Einführung neuer Tools und Systeme blockieren sie den Abschluss von Betriebsvereinbarungen mit Anforderungen an den Datenschutz. Doch jetzt weist das LAG Hessen die Arbeitnehmervertreter in die Schranken. Viele Arbeitgeber kennen es nur zu gut: Bei der Einführung neuer IT-Systeme oder -Komponenten und...