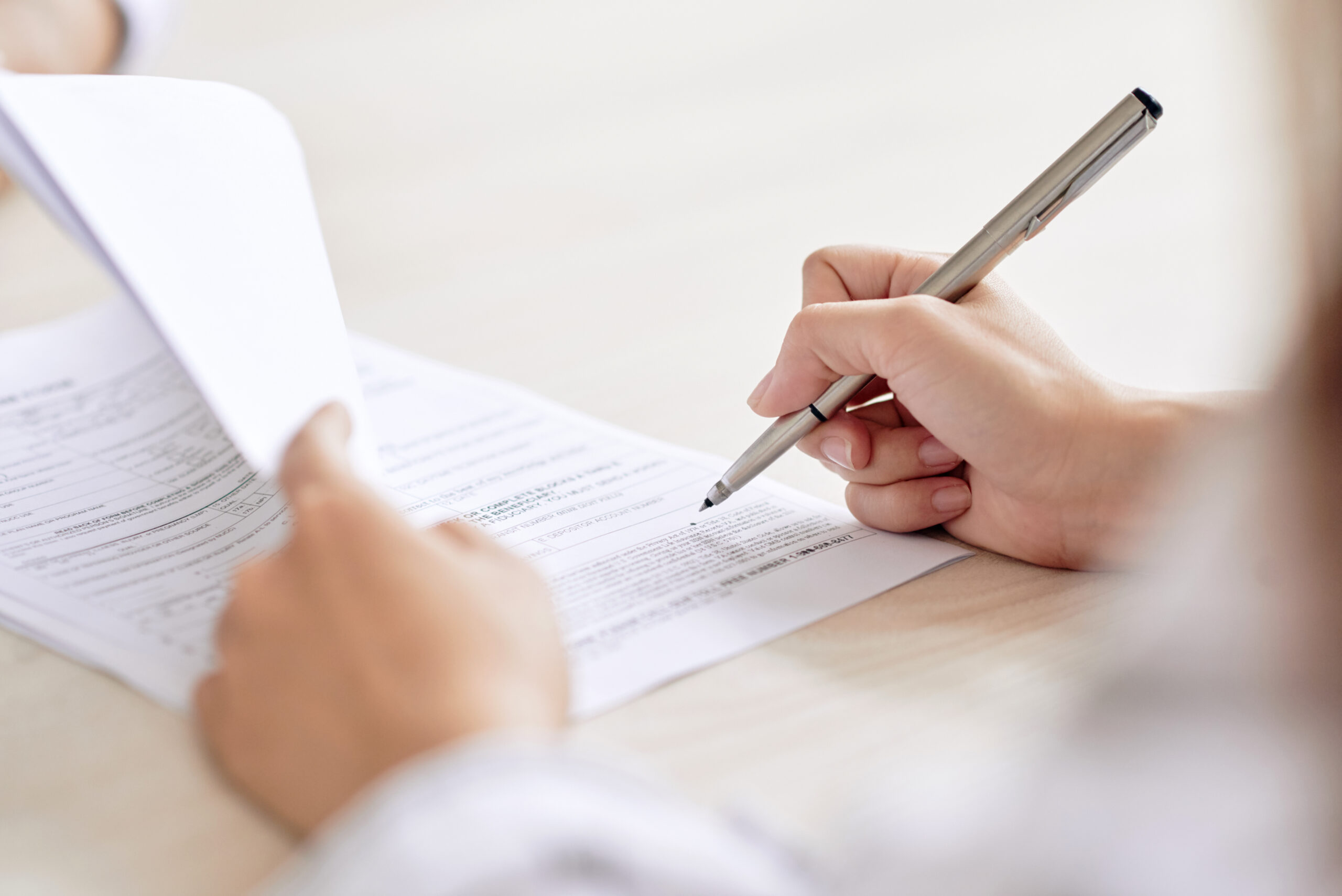Einen Krieg in Europa hatte niemand ernsthaft erwartet. Nun führen der Angriff auf die Ukraine, aber auch die Sanktionen der westlichen Welt schnell zu erheblichen Störungen in den Lieferketten. Wie Unternehmen damit heute umgehen können und wie sie ihre Verträge von morgen absichern sollten, erklärt Dr. Wolfgang Heinze.
Es ist schon das zweite Mal in wenigen Jahren, dass die normalen Spielregeln nicht mehr gelten. Zuerst sorgten das Corona-Virus und die Maßnahmen, die zu seiner Vermeidung erlassen wurden, weltweit für Lieferengpässe. Nun ist geschehen, was noch vor einem Monat fast niemand für möglich hielt: Ein Krieg an Europas Grenzen und die Sanktionen, die die westliche Welt ihm entgegensetzt, haben massive Auswirkungen auch auf die Wirtschaft. Die Fabrik in der Ukraine, die noch vor wenigen Wochen eine Charge Vorprodukte hergestellt und geliefert hat, kann nun zerbombt sein.
Es realisiert sich ein Risiko, das keine der Vertragsparteien bedacht hatte, und das auch keine von ihnen gesetzt oder zu verantworten hat. Um die Interessen beider Vertragsparteien in Ausgleich zu bringen, enthalten gute Verträge für einen solchen Fall eine sog. Force-Majeure-Klausel („Höhere-Gewalt-Klausel“).
Wenn es keine solche Regelung gibt, bietet das Gesetz Lösungen an. Sie sind allerdings mit erheblichen Unsicherheiten behaftet; ob man sich als Vertragspartei wirklich rechtmäßig verhält, wird oft erst viel später durch ein Gericht entschieden.
Das Gesetz: Wann die Leistung unmöglich ist
Bei unüberwindbaren Nachschubproblemen oder Störungen des eigenen Herstellungsprozesses, die nicht in seinen Verantwortungsbereich fallen, kann sich ein Lieferant auf die sog. Unmöglichkeit gemäß § 275 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) berufen. Damit würde er von seiner primären Lieferpflicht frei, müsste also nicht liefern, was er eigentlich vertraglich schuldet. Er verliert aber im Gegenzug auch seinen eigenen Zahlungsanspruch gegen seinen Kunden, § 326 Abs. 1 BGB.
Die Berufung auf eine solche Unmöglichkeit der Leistung ist aber häufig, selbst wenn ihre Voraussetzungen vorliegen, nicht die günstigste Lösung für einen Lieferanten. Zum kompletten Ausfall seiner Einnahmen kann nämlich noch eine Schadensersatzhaftung hinzukommen, etwa für Betriebsausfallschäden, die sein Kunde wegen der verzögerten oder komplett ausgefallenen Lieferung erleidet.
Die Voraussetzungen einer Berufung auf Unmöglichkeit sind zudem hoch. Grundsätzlich trägt schließlich der Lieferant das Beschaffungsrisiko für seine Vorprodukte, so dass auf seiner Seite eine sehr „hohe“ Opfergrenze anzunehmen ist. Ob ein Krieg abweichend von dieser Risikoverteilung ausnahmsweise eine Unmöglichkeit der Lieferung begründet, hängt davon ab, ob der Lieferant alternative Bezugsquellen hätte. Nur wenn es diese gar nicht gibt, wäre die Leistung wirklich unmöglich.
Könnte der Lieferant hingegen, was in aller Regel möglich ist, zum Beispiel die Teile, die er benötigt, anderweitig beziehen, liegt keine Unmöglichkeit im Sinne von § 275 Abs. 1 BGB vor – auch dann nicht, wenn die Ersatzbeschaffung für ihn mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden oder sehr viel teurer wäre. Er könnte die Leistung nur dann verweigern, wenn sein Mehraufwand in einem krassen Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Kunden stünde – eine Frage, die am Ende vermutlich ein Gericht beurteilen müsste.
Die Erwartung von Frieden: Der Wegfall der großen Geschäftsgrundlage
Zweckmäßiger und interessengerechter kann der sog. Wegfall der Geschäftsgrundlage sein (§ 313 BGB). Das Institut bietet die Möglichkeit, den Vertrag anzupassen und notfalls auch zu kündigen. Auch diese Regelung ist nur anwendbar, wenn die Störung der Vertragsbeziehung nicht in den Risikobereich einer der Vertragsparteien fällt, doch verknüpft sie mit der Störung deutlich weniger weit reichende Rechtsfolgen. Sie räumt dem Grundsatz der Bestandskraft des Vertrags mehr Gewicht ein und lässt eine Rückabwicklung erst zu, wenn er nicht angepasst werden kann.
Schon mit Blick auf die Corona-Pandemie wurde im Zweifel der Vertragsanpassung gemäß § 313 BGB gegenüber der Unmöglichkeit und den Leistungsverweigerungsrechten gemäß § 275 BGB der Vorzug gegeben. Das gilt erst recht für Leistungsstörungen aufgrund eines Kriegs. Es gibt bereits höchstrichterliche Rechtsprechung zur sog. „großen Geschäftsgrundlage“: Der Bundesgerichtshof versteht darunter die Erwartung beider Vertragsparteien, dass sich die grundlegenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen eines Vertrags nicht ändern und die Sozialexistenz nicht erschüttert werde. Wird diese Erwartung durch einen Krieg zerstört, rechnet die Rechtsprechung das Risiko von Kriegsschäden keiner der Parteien zu, sondern teilt den Schaden unter ihnen als „Gefahrgemeinschaft“ auf: Es gilt nicht mehr, dass man sich an Verträge zu halten hat, sondern der Vertrag kann nachträglich angepasst werden.
Kein Raum für eine solche Anpassung bleibt nur dann, wenn es stark auf den Liefertermin ankommt und eine spätere Lieferung sinnlos wäre. Ein solches Fixgeschäft kann ausnahmsweise zu einer dauernden Unmöglichkeit führen. Für alle anderen Fälle, in denen eine spätere Leistung noch für die andere Vertragsseite von Interesse ist, bleibt es bei der Anwendbarkeit von § 313 BGB.
Ob ein Gericht aber auf die Störung einer Geschäftsgrundlage im Sinne von § 313 BGB erkennt und wie die Vertragsanpassung dann am Ende aussieht, ist wiederum unsicher. Vor allem bei größeren und langfristigen Vertragsbeziehungen ist daher die Aufnahme einer Force-Majeure-Klausel in den Vertrag sinnvoll.
Die Force-Majeure-Klausel im Vertrag
Da eine solche Höhere-Gewalt-Klausel voraussetzt, dass die höhere Gewalt beim Vertragsschluss nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar war, lässt sie sich nun für bereits eingetretene Fälle höherer Gewalt nicht mehr vereinbaren. Die Corona-Pandemie ist schon da, der Angriffskrieg auf die Ukraine ebenso.
Für zukünftige, vor allem langfristige Geschäftsbeziehungen aber ist die Aufnahme einer solchen Klausel dringend zu empfehlen. Die Formulierung orientiert sich in der Regel an den Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp): Ziffer 12.2 des Empfehlungswerks der Verbände der verladenden Wirtschaft und der Speditionen lautet: „Leistungshindernisse, die nicht dem Risikobereich einer Vertragspartei zuzurechnen sind, befreien die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und den Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Als solche Leistungshindernisse gelten höhere Gewalt, Unruhen, kriegerische oder terroristische Akte, Streiks und Aussperrungen, Blockade von Beförderungswegen sowie sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse.“
Eine Force-Majeure-Klausel, die die neue Realität berücksichtigt, legt eine Rechtsfolge zwischen den Parteien fest, die für mehr Rechtssicherheit und Verbindlichkeit sorgt als die nachträgliche Klärung über § 313 BGB. Die Parteien können die Vertragsauflösung auch an weitere Anforderungen und Stufen binden oder ergänzende Regelungen zu Sorgfaltspflichten in diesen Fällen vereinbaren.
Zwar muss auch eine Force-Majeure-Klausel ausgelegt werden, wenn die beispielhafte Aufzählung von Ereignissen höherer Gewalt gerade den Fall höherer Gewalt, der dann eintritt, nicht ausdrücklich enthält. Für die Konstellation eines Krieges aber können die Parteien klare Vorgaben treffen.
Vorsicht ist allerdings geboten bei der Aufnahme von Force-Majeure-Klauseln in Allgemeine Geschäftsbedingungen, d.h. einseitige Vertragswerke. Grundsätzlich ist eine Force-Majeure-Klausel in AGB zulässig und zu empfehlen. Wird über die Klausel — was der Regelfall ist — nicht individuell verhandelt, darf jedoch auch im B2B-Bereich die Klausel nicht unverhältnismäßig sein und Grundgedanken der gesetzlichen Risikoverteilung zwischen den Parteien widersprechen. Daher darf die beispielhafte Aufzählung in der Klausel nicht allzu umfangreich werden und nur solche Fälle enthalten, die tatsächlich nicht in der Risikosphäre einer der Parteien liegen. Allgemeine Liefer‑, Beschaffungs- oder Finanzierungsrisiken des AGB-Verwenders können und sollten daher nicht in Force-Majeure-Klauseln aufgenommen werden. Kriegerische oder terroristische Vorfälle ebenso wie Pandemien dagegen leider (wieder) schon.
- Tipp: Eine Musterklausel könnte z.B. so aussehen:
„Schwerwiegende Ereignisse, wie insbesondere höhere Gewalt, Unruhen, kriegerische oder terroristische Auseinandersetzungen, behördliche Betriebsschließungen aufgrund einer Pandemie oder Arbeitskämpfe, die unvorhersehbare Folgen für die Leistungsdurchführung nach sich ziehen, befreien die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von ihren Leistungspflichten, selbst wenn sie sich in Verzug befinden sollten. Eine automatische Vertragsauflösung ist damit nicht verbunden. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, einander über ein solches Hindernis unverzüglich zu benachrichtigen und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen, insbesondere die Liefer- oder Leistungsfristen/ ‑termine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist zu verlängern oder zu verschieben.“
Der Autor Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Heinze ist Partner bei SNP Schlawien Rechtsanwälte. Der Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie für Vergaberecht berät schwerpunktmäßig mittelständische Unternehmen sowie Tochtergesellschaften und Niederlassungen deutscher und ausländischer Konzerne in allen Fragen des Handels- und Gesellschaftsrechts. https://de.linkedin.com/in/wolfgang-heinze-a935a324
Über den Autor

Dr. Wolfgang Heinze
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Fachanwalt für Vergaberecht
Aktuelles
Weitere Beiträge des Autors
AGB-Recht im B2B-Verkehr abwählen: Eine Schiedsklausel macht’s möglich
Das deutsche AGB-Recht ist zwingend – auch für Unternehmen untereinander. Doch nun hat der BGH festgestellt, dass Unternehmen bei Verträgen mit Auslandsbezug das deutsche Recht wählen, das AGB-Recht aber ausschließen können. Der Trick ist eine Schiedsklausel. Eine kleine Sensation im B2B-Rechtsverkehr. Ganz nebenbei hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einer Entscheidung aus dem Januar 2025 einen der wohl größten Schmerzpunkte...
Vorsicht bei Change-of-control-Klauseln: Nicht jede Änderung erlaubt die Kündigung
Wer sich dagegen absichern will, dass beim Vertragspartner die Verantwortlichen wechseln, nimmt in Verträge häufig eine Change-of-Control-Klausel auf. Doch pauschale Regelungen gehen oft zu weit. Das OLG Frankfurt a.M. hat eine solche Klausel für unwirksam erklärt – und macht klar, worauf Unternehmen vor allem bei langfristigen Verträgen achten sollten. Das OLG Frankfurt a.M. hat mit Urteil vom 21. Februar...