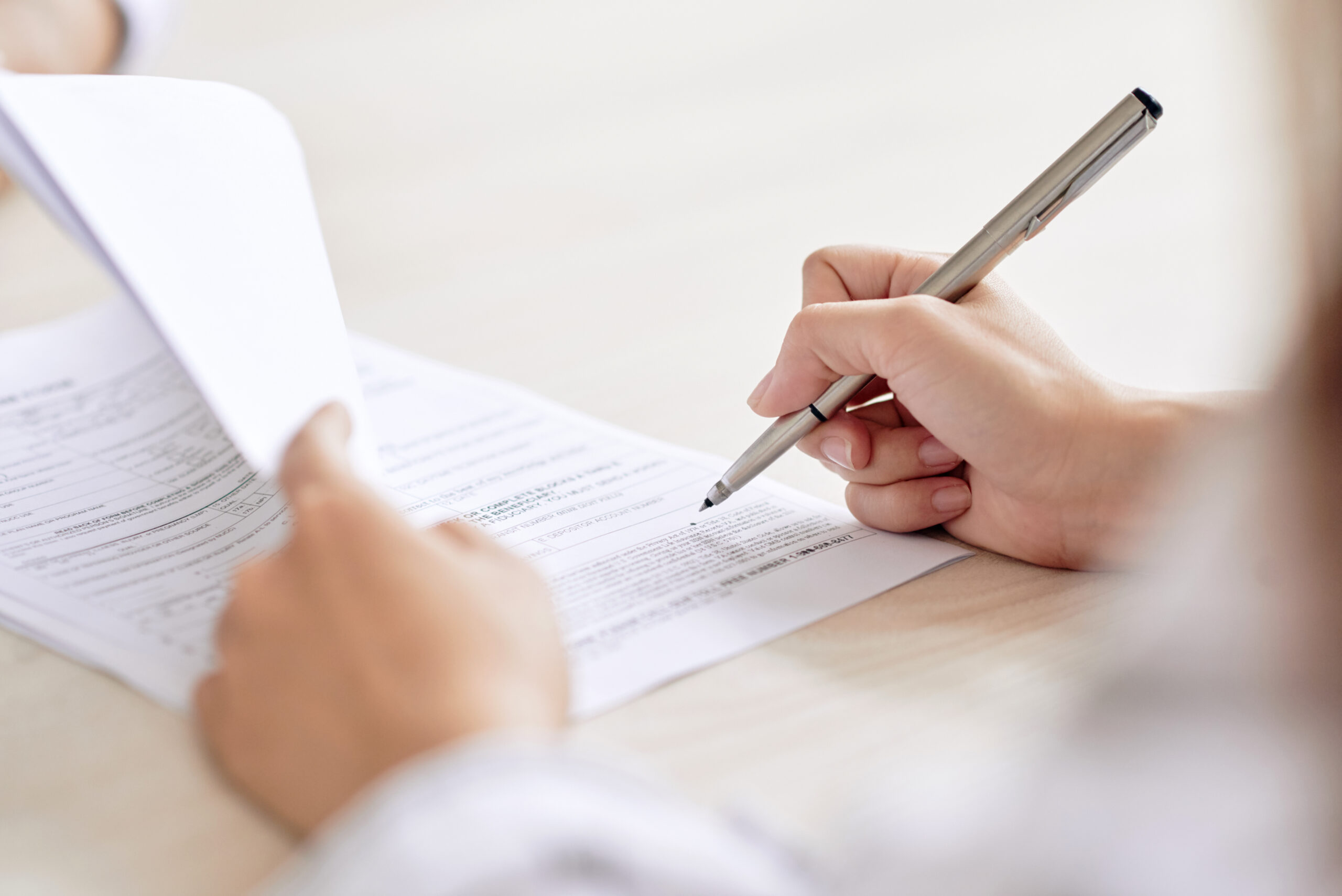Das deutsche AGB-Recht ist zwingend – auch für Unternehmen untereinander. Doch nun hat der BGH festgestellt, dass Unternehmen bei Verträgen mit Auslandsbezug das deutsche Recht wählen, das AGB-Recht aber ausschließen können. Der Trick ist eine Schiedsklausel. Eine kleine Sensation im B2B-Rechtsverkehr.
Ganz nebenbei hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einer Entscheidung aus dem Januar 2025 einen der wohl größten Schmerzpunkte der deutschen Wirtschaft adressiert. Der u.a. für das Schiedsverfahrensrecht zuständige I. Zivilsenat hat es für zulässig erachtet, dass Unternehmen bei Verträgen mit Auslandsbezug ihrem Geschäftsverhältnis das deutsche Recht zugrunde legen, das deutsche AGB-Recht dabei aber ausschließen, und zwar durch eine Verfahrensregelung für Schiedsverfahren. Nur Extremfälle will der BGH auch zukünftig durch den sog. Ordre-Public-Vorbehalt begrenzt sehen.
Das geschah buchstäblich nebenbei, denn diesen vielleicht wichtigsten Inhalt des Beschlusses (v. 09. 01.2025, Az. I ZB 48/24) haben die Karlsruher Richter in einem sog. obiter dictum (lateinisch für „nebenbei gesagt“) versteckt. Für die Gestaltung von Verträgen und die wichtige Frage, ob die Unternehmen sich im Streitfall vor einem staatlichen Gericht treffen oder aber dem Spruch eines privaten Schiedsgerichts unterwerfen wollen, ist das ein gewichtiges Argument. Final entscheidend ist es nicht.
Zum Schiedsgericht ohne deutsches AGB-Recht
Die Parteien in dem Fall, über den der I. Senat zu entscheiden hatte, hatten einen Werkvertrag über die Errichtung eines Car Port Solarkraftwerkes in den Niederlanden geschlossen. Eine Klausel sah vor, dass bei Pflichtverletzungen eine Vertragsstrafe über insgesamt 10% der Netto-Auftragssumme fällig wurde, die nicht auf weitere Schadensersatzansprüche anzurechnen sein sollte. Anwendbares Recht sollte das deutsche Recht sein, außerdem vereinbarten die Unternehmen eine Schiedsklausel mit der Anwendbarkeit der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Internationalen Schiedsgerichtsbarkeit (DIS). In der Schiedsklausel hieß es unter anderem:
„Das in der Sache anwendbare Recht ist unter Klausel 28.1 geregelt. Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, auf die Berufung der Anwendung der §§ 305 bis 310 BGB zu verzichten.“
Nachdem es zu Unstimmigkeiten gekommen war, erhob die Auftragnehmerin Schiedsklage und klagte auf Zahlung ausstehenden Werklohns von rund 3 Millionen Euro. Die Auftraggeberin ihrerseits erhob Widerklage auf Zahlung der Vertragsstrafe.
Die Auftragnehmerin hielt die Vertragsstrafenklausel für nach der deutschen Rechtsprechung zum AGB-Recht unwirksam. Das müsse, so ihre Argumentation weiter, aufgrund der vereinbarten Nicht-Anwendung des AGB-Rechts zur Unwirksamkeit der Schiedsklausel selbst führen. Sie wollte deshalb vom Kammergericht Berlin festgestellt wissen, dass das Schiedsverfahren hier unzulässig sei.
Doch damit kam das Unternehmen nicht weit. Der BGH ordnete die Regelung als Verfahrensregelung zum Schiedsverfahren ein und betrachtete sie getrennt von der eigentlichen Schiedsklausel. Wie zuvor schon das Kammergericht erkannten auch die Bundesrichter diese Schiedsklausel als wirksam an.
BGH: Nur bei krassen Verstößen unwirksam
Dann stellten die Bundesrichter – wie gesagt eher nebenbei – klar, dass allein das angerufene Schiedsgericht darüber entscheide, ob die Rechtswahlklausel mit der Modifizierung durch die Verfahrensregelung und damit auch die Verpflichtung des Schiedsgerichts selbst, das AGB-Recht nicht zu beachten, wirksam ist. Aus Sicht des I. Zivilsenats muss das Schiedsgericht dabei vor allem prüfen, ob das Ergebnis (hier also die Pflicht zur Zahlung der 10 %igen- Vertragsstrafe) „nicht mehr Ausdruck der vertraglichen Selbstbestimmung“ ist und damit gegen den sog. ordre public des deutschen Rechts verstößt oder ob die Klausel zu „schlechthin nicht mehr tragbaren Vertragsfolgen führt“.
Die Schiedsrichter müssen den Vertrag also nach der Entscheidung aus Karlsruhe an den Vorschriften zur Sittenwidrigkeit und zu Treu und Glauben (§§ 138, 242 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) messen, nicht aber an den deutlich strengeren Regelungen des AGB-Rechts (§§ 307 bis 309 BGB).
Hält das Schiedsgericht die Klausel für wirksam, kann die Partei, die im Schiedsverfahren verloren hat, gegen diese Entscheidung das Oberlandesgericht (OLG) anrufen, entweder im Rahmen eines Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahrens (§§ 1060, 1061 ZPO) oder eines Aufhebungsverfahrens (§ 1059 ZPO). Dann überprüft das OLG noch einmal, ob die Voraussetzungen für einen Ordre-Public-Verstoß gegeben sind. Bejaht es das — entgegen dem Schiedsgericht -, muss es den Schiedsspruch aufheben oder dessen Anerkennung oder Vollstreckung verweigern.
Konsequenzen für die Vertragspraxis
Diese Entscheidung des BGH gibt für die zukünftige Gestaltung von Verträgen im B2B-Bereich, d.h. im rein unternehmerischen Geschäftsverkehr, wieder mehr Gestaltungsfreiheit. Sie bietet eine – zwar noch nicht ganz abschließende, aber doch sicherere – Entscheidungsgrundlage für eine Abwahl des AGB-Rechts durch eine Schiedsklausel: Der BGH hat die Wahl des deutschen Rechts unter Abwahl des AGB-Rechts durch eine Verfahrensregelung für Schiedsverfahren als grundsätzlich zulässig erachtet. Nur „Extremfälle“ will er zukünftig durch den ordre public-Vorbehalt begrenzt sehen.
Bei Verträgen mit Auslandsbezug, d.h. wenn die Parteien des Vertrags in unterschiedlichen Staaten sitzen oder der Erfüllungsort im Ausland liegt, bietet sich nun eine solche Abwahl des AGB-Rechts durch eine Schiedsklausel und Verfahrensregelung für das Schiedsgericht an. Dies ist gegenüber einer Klausel, mit der bei grenzüberschreitenden Sachverhalten die Geltung deutschen Rechts unter Ausschluss des AGB-Rechts vereinbart wird, es aber bei der Zuständigkeit staatlicher deutscher Gerichte bleibt, zu empfehlen, da letzteres noch nicht höchstrichterlich geklärt ist.
Kommt jetzt der Boom der Schiedsgerichte?
Und es muss auch auf rein innerdeutsche Sachverhalte zwischen zwei Unternehmen anwendbar sein, wenn diese ein Schiedsverfahren vereinbaren. Der Gesetzgeber hat den Parteien eines Schiedsverfahrens in § 1051 eine Gestaltungsfreiheit bezüglich des Verfahrens eingeräumt. Das spiegelt sich auch im Urteil des BGH.
Bleibt es bei der Zuständigkeit der staatlichen deutschen Gerichte, können die Unternehmen bei rein innerdeutschen Sachverhalten das AGB-Recht hingegen nicht abwählen, da dieses national zwingendes Recht ist. Die nun vom BGH anerkannte Abwahlmöglichkeit durch eine Schiedsklausel dürfte auch in Deutschland zu einem Boom der Schiedsgerichte im unternehmerischen Geschäftsverkehr führen.
Tatsächlich klingt das verlockend. Allerdings ist ein Schiedsverfahren keineswegs immer schneller oder günstiger als ein Prozess vor den ordentlichen Gerichten. Ob es für Unternehmen, die miteinander in geschäftliche Beziehungen treten wollen, tatsächlich die bessere Wahl ist, hängt von vielen Kriterien ab und muss – gerade mit Blick auf die Kosten – in jedem Einzelfall genau geprüft werden. Die Möglichkeit, das AGB-Recht im B2B-Verkehr abzuwählen, gehört ab sofort aber in die Waagschale zugunsten der Schiedsgerichtsbarkeit. Diese Möglichkeit gibt Unternehmen eine jedenfalls weitgehende Rechtssicherheit zurück, die sie über viele Jahre schmerzlich vermisst haben.
Über den Autor

Dr. Wolfgang Heinze
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Fachanwalt für Vergaberecht
Aktuelles
Weitere Beiträge des Autors
Vorsicht bei Change-of-control-Klauseln: Nicht jede Änderung erlaubt die Kündigung
Wer sich dagegen absichern will, dass beim Vertragspartner die Verantwortlichen wechseln, nimmt in Verträge häufig eine Change-of-Control-Klausel auf. Doch pauschale Regelungen gehen oft zu weit. Das OLG Frankfurt a.M. hat eine solche Klausel für unwirksam erklärt – und macht klar, worauf Unternehmen vor allem bei langfristigen Verträgen achten sollten. Das OLG Frankfurt a.M. hat mit Urteil vom 21. Februar...
Beschränkte gesetzliche Auskunftsrechte des Kommanditisten sollten vertraglich erweitert werden
Welche Auskunftsrechte habe ich als Kommanditist? Ein Kommanditist ist ein Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft dessen Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gemäß § 171 Abs. 1 HGB auf die eingetragene Haftsumme beschränkt ist. Er ist – im Gegenzug für das Haftungsprivileg – gemäß § 164 HGB von der Geschäftsführung ausgeschlossen und hat damit nach dem gesetzlichen Regelbild nur begrenzte Möglichkeiten, die...