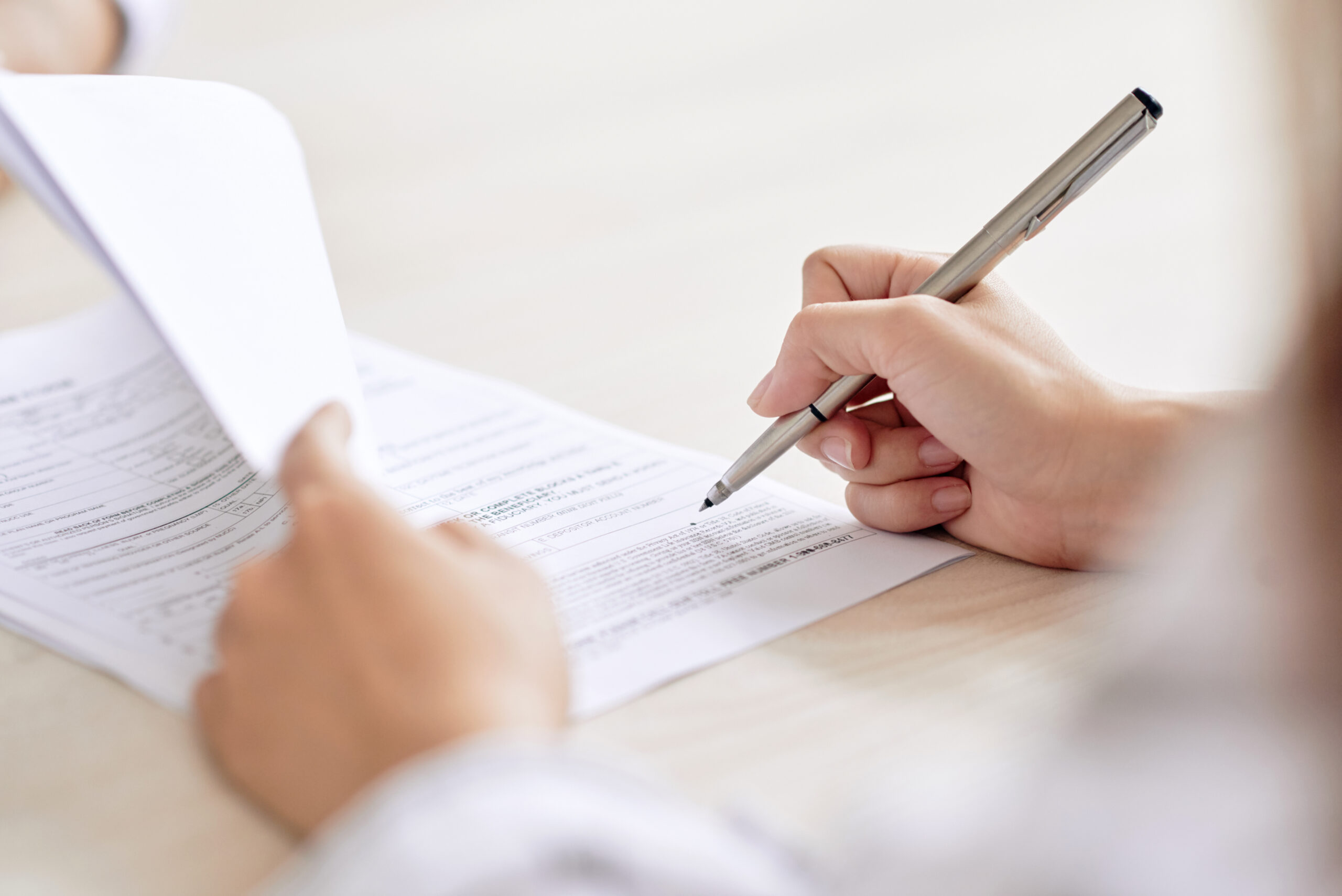Während es in Deutschland Überlegungen gab, das deutsche Lieferkettengesetz auszusetzen, ist Anfang Juli schon die EU-Lieferkettenrichtlinie in Kraft getreten. Sie verlangt mehr Umweltschutz und dehnt die Lieferkette aus. Welche Pflichten neu sind und welche Risiken für Leitungspersonal in Unternehmen noch größer werden.
Konnten wir Anfang März nur berichten, dass sich die Verabschiedung der EU-Richtlinie über Lieferkettensorgfaltspflichten wohl verzögern könnte, ging es in danach plötzlich doch recht schnell: Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) wurde nach Beratungen am 24. April im Europäischen Parlament und am 24. Mai im Europäischen Rat schließlich am 13. Juni verabschiedet. Am 5.Juli 2024 ist sie im Amtsblatt der EU (ABl. L 2024/1760, S. 1ff.) veröffentlicht worden und am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung, also am 3. Juli 2024, in Kraft getreten.
Dies bedeutet zum einen, dass die EU-Mitgliedstaaten die Richtlinie nun gemäß Art. 37 Abs. 1 S. 1 der CSDDD bis zum 26. Juli 2026 in nationales Recht umsetzen müssen. Zum anderen heißt es auch, dass bis zum Ablauf dieser Umsetzungsfrist keine Regelungen mehr erlassen werden dürfen, die das in der Richtlinie vorgeschriebene Ziel ernstlich in Frage stellen könnten (dieses sog. Gebot der effektiven Umsetzung des EU-Rechts und die ihm immanente Vorwirkung der Richtlinie im Verhältnis zwischen EU und Mitgliedstaat hat der EuGH in mehreren Urteilen bestätigt, Rs. C‑129/96, Inter-Environnement Wallonie, C‑144/04, Mangold, C‑246/06, Navarro, C‑427/06, Bartsch, C‑555/07, Kücükdevici).
Wegen dieser europarechtlichen Bindung ist mit einer Aussetzung des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG, umgangssprachlich gern „Lieferkettengesetz“ genannt) für die Zeit bis zum 26. Juli 2026 nun nicht mehr zu rechnen. Dabei gab es sowohl im deutschen Bundestag als auch im Bundeswirtschaftsministerium Überlegungen, das deutsche LkSG auszusetzen, da insbesondere der Kreis der vom LkSG erfassten Unternehmen weiter ist, als der der Richtlinie. Im Raum steht aber nun eine schnellere Anpassung des LkSG an die Richtlinie und damit quasi eine „Rücknahme“ dieser überschießenden Regelungen. Die Richtlinie selbst sieht nach ihrem Art. 4 nur eine Mindestharmonisierung vor.
Zentrale Unterschiede zwischen LkSG und der CSDDD
I. Konkretere Sorgfaltspflichten
Aufbauend auf einem risikobasierten Ansatz etabliert Art. 5 der CSDDD die bereits aus dem LkSG bekannten Bemühenspflichten: Die Geschäftsleiter schulden nicht den unmittelbaren Erfolg der Compliance-Maßnahmen, aber sie müssen sich darum bemühen. Die Richtlinie gibt – anders als bisher im deutschen und europäischen Aktien- und Gesellschaftsrecht vorgesehen – keinen weiten Ermessensspielraum bei der Ausgestaltung von Compliance-Systemen mehr, sondern sieht konkrete Maßnahmen für den Bereich der Menschenrechts- und Lieferketten-Compliance vor.
Diese umfassen:
- die Einführung einer Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, ihre Einbeziehung in die Unternehmenspolitik und in die Risikomanagementsysteme mit einer langfristigen Konzeption des Unternehmens, einen Verhaltenskodex und die Umsetzungsmaßnahmen dazu (Art. 7 Abs. 1 CSDDD);
- die regelmäßige Ermittlung, Bewertung und Priorisierung potenzieller / tatsächlicher negativer Auswirkungen, d.h. Risikoanalysen (Art. 8, Art. 9 CSDDD);
- die Verhinderung und Milderung potenzieller negativer Auswirkungen, d.h. Präventionsmaßnahmen auch zur Vermeidung von mangelhafter Prävention, z.B. durch vertragliche Zusicherungen von z.B. mittelbaren Zulieferern (Art. 10 CSDDD);
- die Beendigung und Milderung von und die Abhilfe bei tatsächlichen negativen Auswirkungen (Art. 11 und 12 CSDDD);
- die Implementierung von Maßnahmen zur Einbeziehung von Stakeholdern mit Vorgaben zu umfassenden Informations- und Konsultationspflichten (Art. 13 CSDDD);
- die Einrichtung eines Beschwerde-Mechanismus, der dafür sorgt, dass im Einzelfall sofort die Pflichten zum Ergreifen von Präventiv- und Abhilfemaßnahem ausgelöst werden (Art. 14 CSDDD);
- ein allgemeines, regelmäßiges Monitoring der Sorgfaltspflichtenprogramme (Art 15 CSDDD).
Zwar sind viele der vorgenannten Sorgfaltspflichten aus dem LkSG dem Grundsatz nach bekannt, doch sind die Pflichten der Unternehmen in der CSDDD deutlich konkreter und präziser definiert, was einerseits die Beachtung, andererseits auch bei Pflichtverletzungen die Ahndung erleichtert. Parallel dazu sind auch die bei Pflichtverstößen eingreifenden Folgen in der Richtlinie bestimmt: Es werden konkrete vertragliche Pflichten auferlegt, die gegenüber den Zulieferern durchzusetzen sind und die am Ende auch auf die Beendigung der Geschäftsbeziehungen verweisen.
II. Erweiterte Sorgfaltspflichten
Unternehmen müssen nun noch stärker auch die Entsorgungswege für Produkte in den Blick nehmen.
Denn die Sorgfaltspflichten nach der CSDDD erstrecken sich auf die gesamte Wertschöpfungskette. Sie erfassen somit nicht nur, wie beim LkSG, die vorgelagerten Geschäftspartner im Zusammenhang mit der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen (Art. 3 Abs. 1 lit. g (i) CSDDD), sondern auch die nachgelagerten Geschäftspartner (Art. 3 Abs. 1 lit. g (ii) CSDDD), wenn diese produktbezogene Dienstleistungen erbringen und für das verpflichtete Unternehmen oder in dessen Namen handeln.
Darüber hinaus muss das verpflichtete Unternehmen die indirekten Geschäftspartner prüfen, d.h. diejenigen, die keine direkte vertragliche Beziehung zu ihm unterhalten, aber mit den Tätigkeiten/ Produkten etc. des verpflichteten Unternehmens in Zusammenhang stehen. Das weitet die Pflichten der Unternehmen erheblich aus und wird sich auch auf die nicht-verpflichteten Zulieferer auswirken. Auf sie wird über Verhaltenskodices und Verträge Druck ausgeübt, entsprechende Prüfpflichten zu übernehmen und zu akzeptieren.
Wie dieser Widerspruch zum Willen auch des Richtlinien-Gebers, die Bedürfnisse von KMU zu berücksichtigen, aufgelöst werden kann, lässt die Richtlinie bislang offen. Inhaltlich bezieht die CSDDD sich im Vergleich zum LkSG zudem auf noch mehr internationale Abkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt, so dass sich die Sorgfaltspflichten insoweit deutlich erweitern.
III. Klimaschutzpläne mit mehr Haftungsrisiken für Leitungspersonal
Art. 22 CSDDD schreibt – anders als das LkSG – die Pflicht der Unternehmen vor, sog. Übergangspläne für den Klimaschutz aufzustellen. Diese müssen gewährleisten, dass das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens mit dem Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft, dem 1,5‑Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens und dem Ziel übereinstimmt, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Art. 22 Abs. 2 CSDDD gibt dazu konkrete einzelne Anforderungen an diese Pläne vor.
Diese Pflicht, Übergangspläne aufzustellen, erweitert die zwingend einzuhaltenden Pflichten und damit die Haftungsrisiken von Geschäftsleitern erheblich. Für Gesellschafter und Aufsichtsorgane besteht Überprüfungs- und Handlungsbedarf nicht nur hinsichtlich der Planaufstellung selbst, sondern auch mit Blick auf die Vergütungspolitik, denn Art. 22 Abs. 1 lit. d CSDDD verlangt, dass im Klimaschutzplan auch die Rolle der Verwaltungs‑, Leitungs- und Aufsichtsorgane im Zusammenhang mit dem Plan beschrieben wird. Dies verpflichtet dazu, sich auch mit der Ausrichtung der Geschäftsführer-/ Vorstands-Vergütung an diesen Zielen auseinanderzusetzen.
Allerdings bezieht sich zumindest die in Art. 29 CSDDD nun neu geregelte zivilrechtliche Haftung der verpflichteten Unternehmen nicht auf die Klimaschutzpläne, sondern entsteht nur bei Verstoß gegen die Pflichten, negative Auswirkungen der eigenen Geschäftstätigkeit zu beheben und Abhilfe zu leisten (Art. 11, 12 CSDDD).
Ausblick
Die deutlich konkretere Fassung der Sorgfaltspflichten, die die Unternehmensorgane einhalten müssen, in der CSDDD – auch im Hinblick auf die Klimaschutzpläne – schränken den Umsetzungsspielraum der nationalen Gesetzgeber erheblich ein. Wie auch bei anderen europäischen Richtlinien ist mit einer weitgehend wörtlichen Übernahmen der Regelungen aus der CSDDD zu rechnen.
Die spezifisch beschriebenen Sorgfaltspflichten verschärfen zudem die Haftungsrisiken für die Unternehmen, da Art. 29 CSDDD anders als das LkSG eine Haftung bei Verletzung der Bemühenspflichten vorsieht. Anders als das deutsche Lieferkettengesetz will die CSDDD nicht nur etwaig entstandene Schäden ausgleichen, sondern gerade auch das Verhalten der Unternehmensleitungen steuern und diese abschrecken.
Gestärkt wird – auch das eine Neuerung – die Position des Geschädigten auch im Bereich des Zivilprozesses: Art. 29 Abs. 3 lit. a CSDDD verlangt eine nationale Bestimmung für das Gerichtsverfahren, die es den Gerichten erlaubt, gegenüber einem beklagten Unternehmen anzuordnen, dass es Beweismitteln offenlegen muss, die in seiner Verfügungsgewalt sind. Dazu muss ein vermeintlich geschädigter Kläger nur schlüssig vortragen und auf solche zusätzlichen Beweismittel beim Unternehmen hinweisen. Der deutsche Gesetzgeber wird prüfen, ob die aktuellen Möglichkeiten der §§ 421ff., 142 Zivilprozessordnung vor dem Hintergrund der bislang eher zurückhaltenden Anwendungspraxis deutscher Gerichte zu diesen Bestimmungen ausreichen. Geleitet von dem Gedanken einer effektiven Umsetzung der europäischen Lieferkettensorgfaltspflichten für Unternehmen könnte insoweit ein deutlicher Wandel der deutschen zivilprozessualen Praxis drohen und den Unternehmen die Abwehr von Klagen deutlich erschwert werden.
Über den Autor

Dr. Wolfgang Heinze
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Fachanwalt für Vergaberecht
Aktuelles
Weitere Beiträge des Autors
AGB-Recht im B2B-Verkehr abwählen: Eine Schiedsklausel macht’s möglich
Das deutsche AGB-Recht ist zwingend – auch für Unternehmen untereinander. Doch nun hat der BGH festgestellt, dass Unternehmen bei Verträgen mit Auslandsbezug das deutsche Recht wählen, das AGB-Recht aber ausschließen können. Der Trick ist eine Schiedsklausel. Eine kleine Sensation im B2B-Rechtsverkehr. Ganz nebenbei hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einer Entscheidung aus dem Januar 2025 einen der wohl größten Schmerzpunkte...
Vorsicht bei Change-of-control-Klauseln: Nicht jede Änderung erlaubt die Kündigung
Wer sich dagegen absichern will, dass beim Vertragspartner die Verantwortlichen wechseln, nimmt in Verträge häufig eine Change-of-Control-Klausel auf. Doch pauschale Regelungen gehen oft zu weit. Das OLG Frankfurt a.M. hat eine solche Klausel für unwirksam erklärt – und macht klar, worauf Unternehmen vor allem bei langfristigen Verträgen achten sollten. Das OLG Frankfurt a.M. hat mit Urteil vom 21. Februar...