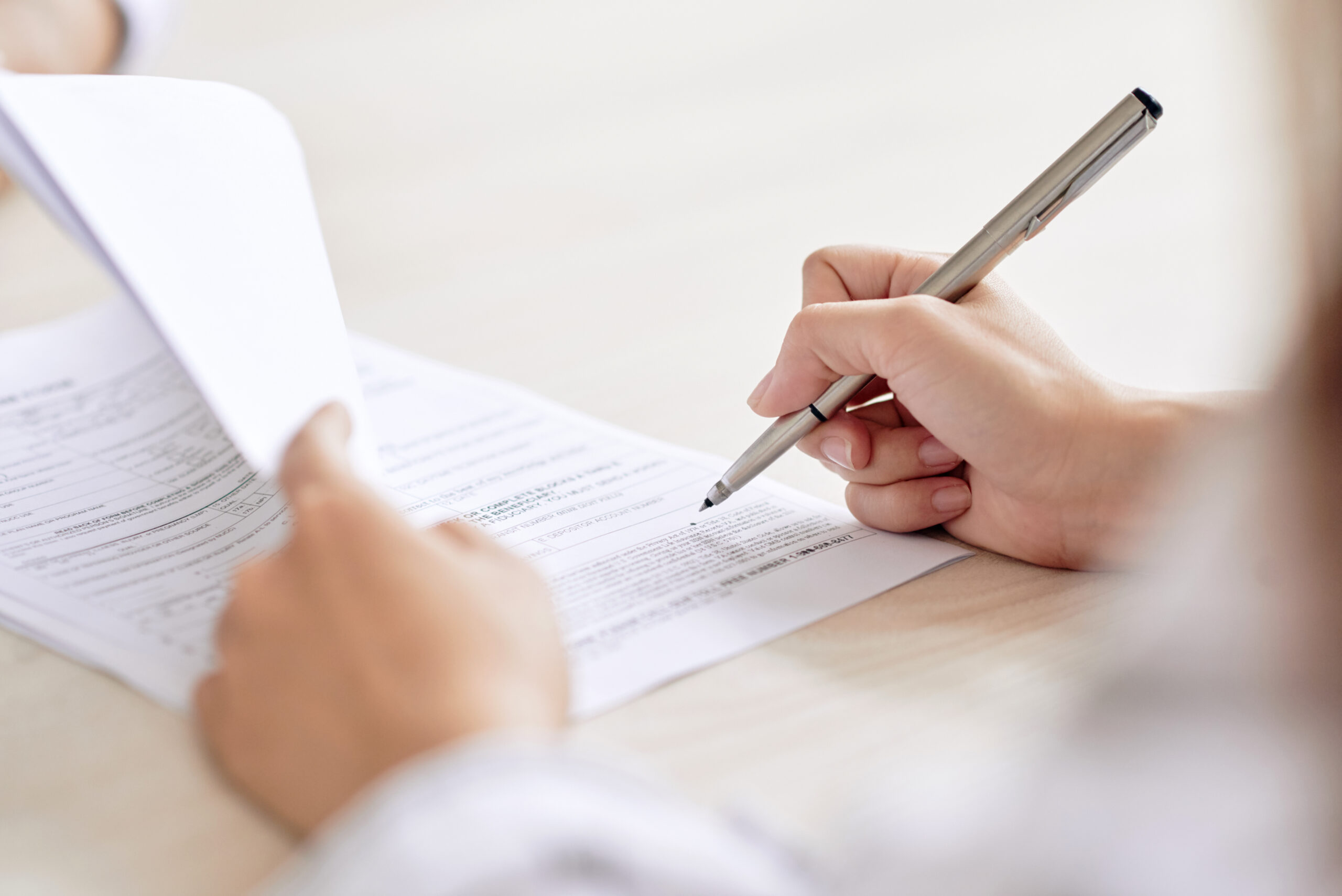Wer ist neben mir noch an der Gesellschaft beteiligt – und in welchem Umfang? Ein aktuelles Urteil stellt klar, dass Gesellschafter in einer Publikums-KG einen Anspruch auf Antworten auf diese Fragen haben, und zwar auch bei Beteiligung einer Treuhandgesellschaft. Fast nichts kann daran etwas ändern.
Die Karlsruher Richterinnen und Richter hatten über den Fall eines Anlegers/Gesellschafters zu entscheiden, der über eine Treuhandkommanditistin an zwei Publikumsgesellschaften, sog. Fondsgesellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co. KG, beteiligt war. Weil er plante, weitere Anteile zu erwerben, wollte er von der Treuhandgesellschaft Auskunft über die Daten der übrigen Gesellschafter – insbesondere ihre Namen, Anschriften und Beteiligungshöhen. Die Treuhandgesellschaft aber verweigerte die Herausgabe und berief sich dabei auf vermeintliche datenschutzrechtliche und entgegenstehende gesellschaftsvertragliche Regelungen.
Der Bundesgerichtshof ließ das nicht gelten: Das Recht, seine Mitgesellschafter zu kennen, sei ein unentziehbares mitgliedschaftliches Recht eines Gesellschafters einer Publikumspersonengesellschaft, befand der für das Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat (BGH, Beschl. v. 22.01.2025, Az. II ZB 18/23). Dies gelte auch, wenn die Beteiligung nicht unmittelbar, sondern über eine Treuhänderin erfolgt. Entscheidend sei, dass der Anleger im Innenverhältnis wie ein Gesellschafter gestellt ist. Das Urteil konturiert den Auskunftsanspruch weiter und stärkt so die Rechte der Gesellschafter großer Personengesellschaften. Umgekehrt bedeutet es auch: Wer sich an einer Personengesellschaft beteiligt, muss damit rechnen, dass seine persönlichen Daten Mitgesellschaftern oder Treugebern bekannt werden – ein Recht auf Anonymität gibt es insoweit nicht.
Auch Treuhand-Konstruktion schafft keine Anonymität
Der Auskunftsanspruch des Gesellschafters folgt aus dem Informationsrecht gemäß § 166 Abs. 1 S. 2 HGB. Die mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts zum 1. Januar 2024 neu eingeführte Vorschrift setzt die bisherige Rechtsprechung bezüglich des Auskunftsanspruchs in Gesetzesrecht um. Sie regelt, dass ein Kommanditist von der Gesellschaft Auskunft über die Gesellschaftsangelegenheiten verlangen kann, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Mitgliedschaftsrechte erforderlich ist.
Nach der nun kodifizierten und damit vom Gesetzgeber ausdrücklich gebilligten Rechtsprechung ist das Recht, seinen Vertragspartner und damit seine Mitgesellschafter zu kennen, ein unentziehbares mitgliedschaftliches Recht aus dem Gesellschaftsvertrag als solchem. Es steht, das betont der Senat, nicht nur dem unmittelbaren Gesellschafter einer Personen– oder Personenhandelsgesellschaft zu, sondern auch Treugebern, die zwar nicht unmittelbar, aber wirtschaftlich beteiligt sind, solange sie im Innenverhältnis nach dem Gesellschaftsvertrag in der Publikums-Personenhandelsgesellschaft den Status eines Gesellschafters haben.
Mit seiner Entscheidung stellt der BGH klar, dass sich andere Gesellschafter in derartigen Fondsgesellschaften nicht hinter Treuhändern verstecken können, sondern der Treuhänder den Mitgesellschaftern Auskunft über die Person des Treugebers geben muss. Eine Treuhand-Konstruktion bei Publikums-Personenhandelsgesellschaften sichert insofern nicht die Anonymität der anderen Gesellschafter gegenüber den Mitgesellschaftern. Als Gesellschafter einer Personengesellschaft muss man vielmehr damit rechnen, dass anderen Gesellschaftern neben der Höhe der eigenen Beteiligung auch der Name und die Anschrift mitgeteilt werden.
Sachliche Gründe sind schnell gefunden
Eine anlasslose, pauschale Informationsbeschaffung – etwa in der Absicht, vorsorglich die Redlichkeit der Geschäftsführung zu überprüfen – wäre indes nicht vom Schutzzweck des Auskunftsrechts gedeckt. Ob ein Gesellschafter die Daten bekommt, ist vielmehr das Ergebnis einer Abwägung: Überwiegen die Interessen des Gesellschafters an der Auskunft diejenigen der Gesellschaft und der Mitgesellschafter daran, die Daten nicht herauszugeben?
Doch um ein Auskunftsrecht zu bejahen, reicht dem BGH schon ein sachlicher Grund, der auf das Zusammenwirken der Gesellschafter zur Willensbildung in oder außerhalb der Gesellschafterversammlung gerichtet ist.
Als solche sachliche Gründe akzeptiert die Rechtsprechung z.B. folgende Fallgestaltungen:
- Der Gesellschafter möchte eine bestimmte Stimmenmehrheit in einer Abstimmung in der Gesellschafterversammlung organisieren.
- Der Gesellschafter möchte seinen Mitgesellschaftern Kaufangebote für ihre Anteile unterbreiten.
- Er will seine eigene Beteiligung gegenüber den Mitgesellschaftern. kündigen.
- Er will spezifische Informationen zu Verträgen der Gesellschaft mit einzelnen Gesellschaftern erfahren.
In all diesen Fällen liegen ausreichende sachliche Gründe vor, die Gesellschaft muss die Namen, Adressen und Beteiligungsverhältnisse der Mitgesellschafter herausgeben. Der BGH sieht darin auch keine Belästigung der anderen Gesellschafter: Selbst wenn sie möglicherweise unerwünschte Kaufangebote erhalten sollten, stünde es ihnen schließlich frei, diese anzunehmen oder abzulehnen.
Auch Vertrag und DSGVO helfen nicht
Besonders deutlich bestätigt der BGH erneut, dass das Auskunftsrecht auch durch Regelungen im Gesellschafts- oder Treuhandvertrag nicht ausgeschlossen werden kann. Als unentziehbares mitgliedschaftliches Recht könne es auch durch vertragliche Regelungen nicht abbedungen werden, eine solche Regelung wäre unwirksam, betonen die Karlsruher Richter. Die einzigen Grenzen seien das Verbot der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242 BGB) und das Schikaneverbot (§ 226 BGB).
Auch das Datenschutzrecht konnte den Auskunftsanspruch des Gesellschafters nicht einschränken. Schließlich ist die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zulässig, wenn sie zur Vertragserfüllung – hier: zur Ausübung mitgliedschaftlicher Rechte – erforderlich ist. Einer Einwilligung der anderen Gesellschafter bedarf es hierzu nicht.
Obwohl der Europäische Gerichtshof (EuGH, Urt. v. 12.09.2024, Az. C‑17/22, C‑18/22) die Herausgabe personenbezogener Daten kürzlich als möglicherweise nicht erforderlich im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO eingestuft hat, wenn ein Vertrag es ausdrücklich verbiet, die personenbezogenen Daten betreffend die mittelbaren Anleger anderen Anteilseignern mitzuteilen, hält der BGH die Herausgabe der Daten weiterhin für datenschutzkonform.
Die datenschutzrechtliche „Erforderlichkeit“ dürfe nicht schematisch beurteilt werden, so der II. Zivilsenat, es gehe vielmehr um den Zweck, zu welchem die Auskunft verlangt werde. Gehe es dem Gesellschafter darum, im Vorfeld gesellschaftsrechtlicher Willensbildung Kontakt mit Mitgesellschaftern aufzunehmen – etwa zur Vorbereitung einer Stimmabgabe oder zur Abstimmung über ein gemeinsames Vorgehen –, könne eine personenbezogene Auskunft durchaus erforderlich sein. Etwas anderes würde gelten, wenn die Auskunft bloß gewünscht würde, um eventuell weitere Anteile zu erwerben — dann dürften die Interessen der Gesellschaft und der Mitgesellschafter überwiegen.
Praxishinweise: Verträge zulässig gestaltet?
Das Urteil, das zu einer Publikums-KG, d.h. einer Personengesellschaft mit einem großen Kreis an mittelbaren Gesellschaftern ergangen ist, dürfte auch auf kleinere Gesellschaften übertragbar sein, bei denen durch offen gelegte Treuhandkonstruktionen der Treugeber wie ein Gesellschafter behandelt wird.
Wichtig ist, dass auch eine Treuhandstruktur keine Sicherheit für die Gesellschafter bietet. Der BGH stellt klar: Auch mittelbar Beteiligte haben ein umfassendes Auskunftsrecht, welches sich weder vertraglich noch datenschutzrechtlich wirksam einschränken lässt.
Publikumsgesellschaften und Treuhandmodelle sollten ihre Verträge daher auf unzulässige Beschränkungen überprüfen und für die Zukunft sicherstellen, dass sie keine Klauseln enthalten, die das Auskunftsrecht von Anlegern unzulässig einschränken. Zugleich schafft die Entscheidung Rechtssicherheit für Gesellschafter, die ihre Mitgliedschaft aktiv wahrnehmen oder Anteile übertragen möchten – und stärkt somit die Transparenz innerhalb der Gesellschaft.
Über den Autor

Dr. Wolfgang Heinze
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Fachanwalt für Vergaberecht
Aktuelles
Weitere Beiträge des Autors
AGB-Recht im B2B-Verkehr abwählen: Eine Schiedsklausel macht’s möglich
Das deutsche AGB-Recht ist zwingend – auch für Unternehmen untereinander. Doch nun hat der BGH festgestellt, dass Unternehmen bei Verträgen mit Auslandsbezug das deutsche Recht wählen, das AGB-Recht aber ausschließen können. Der Trick ist eine Schiedsklausel. Eine kleine Sensation im B2B-Rechtsverkehr. Ganz nebenbei hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einer Entscheidung aus dem Januar 2025 einen der wohl größten Schmerzpunkte...
Vorsicht bei Change-of-control-Klauseln: Nicht jede Änderung erlaubt die Kündigung
Wer sich dagegen absichern will, dass beim Vertragspartner die Verantwortlichen wechseln, nimmt in Verträge häufig eine Change-of-Control-Klausel auf. Doch pauschale Regelungen gehen oft zu weit. Das OLG Frankfurt a.M. hat eine solche Klausel für unwirksam erklärt – und macht klar, worauf Unternehmen vor allem bei langfristigen Verträgen achten sollten. Das OLG Frankfurt a.M. hat mit Urteil vom 21. Februar...